Just Can't Get Enough
[Musikexpress, Februar 2005. Text: Oliver Götz. Foto: YDL / Rex Feature.]

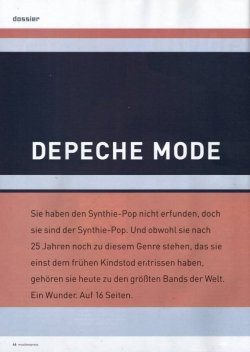



Sie sind die Rolling Stones des Synthie-Pop – eines Genres, das kaum größer ist als diese Band selbst. Der Versuch, ein Phänomen zu erklären das Phänomen Depeche Mode.
Einem Irrtum, den alle möglichen und vor allem unmöglichen 80’s-Hit-Kollektionen in die Popwelt der folgenden Jahre hinaus getragen haben, gilt es gleich am Anfang zu beseitigen: New Wave war nicht Synthie-Pop. Wirklich nicht. Vielmehr eröffneten Menschen mit Geschmack so um das Jahr 1981 eher folgende Gleichung: New Wave = Cool / Synthie-Pop = gar nicht cool. Und wenn’s trotzdem unbedingt Synthie-Pop sein musste, dann bitteschön Visages „Fade to Grey” (geheimnisvoll), Soft Cells „Tainted Love” (hinreißend und anrüchig) oder Human Leagues „Being Boiled” (erhaben und sehr, sehr kühl). Aber „Dreaming Of Me”, dieses Liedchen – von Depeche Mode, diesen Jüngelchen?!
Wenn OMD die Reagenzglas-Söhne von Kraftwerk waren, Gary Numan deren erster funktionierender Replikant, der dann aber zum Neo -Glam übergelaufen ist, während Human League die Sex-Verneinung der Düsseldorfer Eigenentsafter aufhoben, was sollten dann bitteschön Depeche Mode sein? Ein Witz. Ja, das waren sie wohl, dass konnte jeder sehen und hören – sie waren Polunderpop gegen die Kälte dieses betont coolen Genres, mit ernstem Teenie-Gesicht zum einfältigen Spiel mit manchmal Moll gewordenen Kinderliedmelodien, ein bisschen eckiges Gehopse, und was der Sequencer hat so hergibt, wenn er von emsigen Amateuren bedient wird.
-Glam übergelaufen ist, während Human League die Sex-Verneinung der Düsseldorfer Eigenentsafter aufhoben, was sollten dann bitteschön Depeche Mode sein? Ein Witz. Ja, das waren sie wohl, dass konnte jeder sehen und hören – sie waren Polunderpop gegen die Kälte dieses betont coolen Genres, mit ernstem Teenie-Gesicht zum einfältigen Spiel mit manchmal Moll gewordenen Kinderliedmelodien, ein bisschen eckiges Gehopse, und was der Sequencer hat so hergibt, wenn er von emsigen Amateuren bedient wird.
Das Schicksal dieser Band war vorbestimmt, und jeder popkulturell nicht allzu kurzsichtige Beobachter taugte deshalb zum Seher: Depeche Mode sind ein One-Hit-Wonder. Oder gar eine Non-Hit-Wonder. Doch auch das war ein großer Irrtum: Dass Depeche Mode bis heute auf kaum einer der 80’s-Compilations verramscht werden, liegt daran, dass sie gegen alle Kritiker-Prophezeiungen und Wetten der Hüter des coolen Geschmacks irgendwann zwischen 1981 und 2005 zu den Rolling Stones des Synthie-Pop geworden sind (eines Genres, welches in der Folge allerdings nie irgendwelche Led Zeppelins, Nirvanas oder Strokes hervorzubringen wusste). Damit waren Kraftwerk also Muddy Waters gewesen – und die blassen Buben aus Basildon schon gute fünf Jahre nach ihrer Gründung einzigartig. Heute – inzwischen kamen (und gingen zum Teil weider) HipHop, Techno, Grunge, TripHop, Elektronika, Retro-Garagenrock – sind sie nur noch einzigartiger.
Sie füllen Arenen auf beiden Seiten des großen Teichs mit einer Musik, die dazu nach einschlägiger Rock-Gelehrten-Meinung absolut untauglich ist. Sie verkaufen verlässlich Millionen und Abermillionen von Tonträgern an ein so großes wie nibelungentreues Gefolge, welches siches eines Tages einvernehmlich dazu entschieden hatte, ausdrücklich und für immer zu verneinen, dass Synthie-Pop eine Trendlaune der ohnehin nich gerade wohlwollend beleumundeten Pop-Achtziger zu bleiben hat.
Denn machen wir uns nicht vor: „Synthie-Pop” beschreibt nach 25, an Soundupdates ja nicht armen Jahren immer noch am besten, was Depeche Mode tun – und wohl auch wieder tun werden: Während Sie diesen Text lessen, schreiben die Drei in einem Studio irgendwo in Nordamerika gegen alle, zuletzt vor allem internen, Wiederstände weiter an ihrer Erfolgsgeschichte.
Die Wird sich eines Tages selbst in ihrer Heimat Großbritannien (wo man Depeche Mode bis heute partout nicht Ernst nehmen darf) wie in Frankreich, Japan, USA oder sonstwo schon verrückt genug lessen. Doch was diese Elektropopper aus Essex für Deutschland – und was Deutschland für Depeche Mode bedeutet, sprengt so ziemlich alle rockhistorischen Dimensionen, zumindest hierzulande: Martin L. Gore, Dave Gahan und Andrew Fletcher besitzen Heiligenstatus. Ihre Konzerte sind Messen der kollektiven Euphorie und uneingeschränkten Zuneigung, in denem jeder auch ohne Gesangsbuch jede Zeile mitsingt – und bei „Personal Jesus” den Refrain als letzte Mittel der Ehrerbietung auch noch umdichtet: Statt „Reach out and touch faith” gellt dem halbnackten Objekt der Begierde jedesmal ein ohrenbetäubendes „… touch Dave!” entgegen. Der Kreis der Anhänger ist riesig; der der Sympathisanten auch. In fast jeder gr ßeren Stadt gibt es regelmäßige Depeche-Mode-Partys, die bestens besucht werden von Menschen zweier bis dreier Generationen, die gar nicht verstehen können was einem daran langweilig werden sollte. Allen Außenstehenden darf hierzu noch einmal ins Gedächtnis gerufen werden: Wir reden hier nicht von einem Trend, nicht von Nostalgie. Wir reden nicht von Welle, Zeitgeist, Mode – wir reden von Depeche Mode.
ßeren Stadt gibt es regelmäßige Depeche-Mode-Partys, die bestens besucht werden von Menschen zweier bis dreier Generationen, die gar nicht verstehen können was einem daran langweilig werden sollte. Allen Außenstehenden darf hierzu noch einmal ins Gedächtnis gerufen werden: Wir reden hier nicht von einem Trend, nicht von Nostalgie. Wir reden nicht von Welle, Zeitgeist, Mode – wir reden von Depeche Mode.
Wie Depeche Mode diesen Status des Unangreifbaren erreichen konnten, lässt sich nicht so einfach erklären (allerdings wird dieses wohl nicht zuletzt sogr in Haus- und Magisterarbeiten versucht, geschrieben von Die-Hard-Fans, die sich über eine so lange Zeit eben nur mit dem einem Thema beschäftigen woollen und können). Eine Grundvorauusetzung für ihren über mehr als zweie Jahrzehnte nich abflaugenden Erfolg liegt aber zweifellos in Martin L. Gores herausragendem (spätestens ab dem ‘84er Album Some Great Reward offen liegendem) Talent, sich in Serie Songs einfallen zu lassen, bie bei genauerem Hinhören ungeachtet von Sound und Vortrag wie ein Geheimnis dargereicht werden in feierlichen, sich gegenseitig umgarnenden und amarmenden Melodienlinien, die aus Melancholie, Hymnus und etwas Kitsch jenen Menschen allerlei Sakralbauten in die Herzen türmen, die sich das gerne gefallen lassen. Depeche Mode-Alben hießen am Ende ja nicht von ungefähr Black Celebration und Music For The Masses. Gore schafft Hits, die nur selten nach dem klingen, was Hits landläufig ausmacht. Sie sind nicht volksnah, sie machen das Leben nicht geschmeidiger, sie laden meistens eben gerade nicht zum Mitsingen ein.
Dass nichtsdestotrotz genau das immer weider und auch immer weider neue, junge Fans in ausverkauften Sportarenen tun, weil es Depeche Mode nämlich bis heute verstehen, alle paar Monate durch ein weiteres Stück Pop in fast vollständiger Ignoranz der Konkurrenz Relevanz, sogar oberste Priorität einzuklagen, machte die Rolling-Stones-Werdung dieser Gruppe überhaupt erst möglich.Andernfalls wäre sie wohl längst auf ihrer kleinen Synthie-Pop-Insel verendet. Auf der einen Seite hat sich die Band zuvorderst dank Gores Talent einen eigenen Stil geschaffen, der nur von wenigen Epigonen mäßig Gewinn bringend kopiert wurde. Tatsächlich können die einfachen Zutaten noch so klar auf dem Notenständer liegen: Selbst an der simplen Coverversion eines Depeche-Mode-Liedes scheiterte bislang noch so ziemlich jeder in Versuchung Geratene (zwei rühmliche Ausnahmen: Johnny Cash und Monta). Auf der anderen Seite bedreutet Stil für Depeche Mode nicht, nur an Bewährtem festzuhalten. Album für Album, Schritt für Schritt hat sich ihr Sound bis heute unfallfrei, im Gegenteil: sehr geschmackssicher, sogar eine Modernisierung erfahren, in der sich die Band nie irgendwelchen Trends anbiederte. Zwar ließen sich die Vier bereits 1984 in Berlin – unter der Erfüllung des Tatbestandes des Diebstahls von Einstürzende-Neubaten-Samples, wie es hieß – den Sound für „People Are People” und „Master And Servant” kräftig aufscheppern; bald mussten zukräftigere Hymnen her, die in großen Bowls festlich nachklingen; irgendwann wollten dave und martin außerdem richtig rocken, mit Gitarre und langen Haaren; und tatsächlich hatte Meister Gore sein Ohr jederzeit nahe an der experimentellen elektronischen Musik – doch mehr als ein dumpferer Bassschlag hier, ein einsamer Warp-Piepser da und ein bisschen Kölner Geknispel im gesetzteren Spätwerk ließ man sich nicht durchgehen. Depeche Mode sind – die Erkenntnis darf ein Vierteljahrhundert nachdem Synthesizermusik das Modernste war, was man sich nur vorstellen konnte, als gesichert gelten – eine äußerst konservative Band. Und sie sind vielleicht auch nur deshalb eine Elektroband, weil es in den Monaten ihrer Anfänge eben f:urchterlich angesagt war, mithilfe von Synthesizern und Rhythmuscomputern Musik zu machen. Aber sie sind auf jeden Fall durch und durch, mit ganzer Hingabe eine Popband, weil sie eine Songband sind. We sich das noch einmal vergegenwärtigt, kann wohl erst recht nicht verstehen, warum es den meisten angeren Musikante nicht gelingen will, ihrerseits daraus Profit zu ziehen. Es scheint, als seien eben noch lange nicht alle Irrtümer rund um diese Band beseitigt. Ihnen und uns soll’s nur Recht sein.
[Musikexpress, Februar 2005. Text: Oliver Götz. Foto: YDL / Rex Feature.]
Mit vielen dank Romy Cabada und Dennis Burmeister für das Helfen, diesen Artikel zu liefern. [1206 wörten]

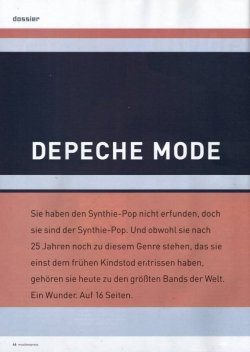



Sie sind die Rolling Stones des Synthie-Pop – eines Genres, das kaum größer ist als diese Band selbst. Der Versuch, ein Phänomen zu erklären das Phänomen Depeche Mode.
Einem Irrtum, den alle möglichen und vor allem unmöglichen 80’s-Hit-Kollektionen in die Popwelt der folgenden Jahre hinaus getragen haben, gilt es gleich am Anfang zu beseitigen: New Wave war nicht Synthie-Pop. Wirklich nicht. Vielmehr eröffneten Menschen mit Geschmack so um das Jahr 1981 eher folgende Gleichung: New Wave = Cool / Synthie-Pop = gar nicht cool. Und wenn’s trotzdem unbedingt Synthie-Pop sein musste, dann bitteschön Visages „Fade to Grey” (geheimnisvoll), Soft Cells „Tainted Love” (hinreißend und anrüchig) oder Human Leagues „Being Boiled” (erhaben und sehr, sehr kühl). Aber „Dreaming Of Me”, dieses Liedchen – von Depeche Mode, diesen Jüngelchen?!
Wenn OMD die Reagenzglas-Söhne von Kraftwerk waren, Gary Numan deren erster funktionierender Replikant, der dann aber zum Neo
Das Schicksal dieser Band war vorbestimmt, und jeder popkulturell nicht allzu kurzsichtige Beobachter taugte deshalb zum Seher: Depeche Mode sind ein One-Hit-Wonder. Oder gar eine Non-Hit-Wonder. Doch auch das war ein großer Irrtum: Dass Depeche Mode bis heute auf kaum einer der 80’s-Compilations verramscht werden, liegt daran, dass sie gegen alle Kritiker-Prophezeiungen und Wetten der Hüter des coolen Geschmacks irgendwann zwischen 1981 und 2005 zu den Rolling Stones des Synthie-Pop geworden sind (eines Genres, welches in der Folge allerdings nie irgendwelche Led Zeppelins, Nirvanas oder Strokes hervorzubringen wusste). Damit waren Kraftwerk also Muddy Waters gewesen – und die blassen Buben aus Basildon schon gute fünf Jahre nach ihrer Gründung einzigartig. Heute – inzwischen kamen (und gingen zum Teil weider) HipHop, Techno, Grunge, TripHop, Elektronika, Retro-Garagenrock – sind sie nur noch einzigartiger.
Sie füllen Arenen auf beiden Seiten des großen Teichs mit einer Musik, die dazu nach einschlägiger Rock-Gelehrten-Meinung absolut untauglich ist. Sie verkaufen verlässlich Millionen und Abermillionen von Tonträgern an ein so großes wie nibelungentreues Gefolge, welches siches eines Tages einvernehmlich dazu entschieden hatte, ausdrücklich und für immer zu verneinen, dass Synthie-Pop eine Trendlaune der ohnehin nich gerade wohlwollend beleumundeten Pop-Achtziger zu bleiben hat.
Denn machen wir uns nicht vor: „Synthie-Pop” beschreibt nach 25, an Soundupdates ja nicht armen Jahren immer noch am besten, was Depeche Mode tun – und wohl auch wieder tun werden: Während Sie diesen Text lessen, schreiben die Drei in einem Studio irgendwo in Nordamerika gegen alle, zuletzt vor allem internen, Wiederstände weiter an ihrer Erfolgsgeschichte.
Die Wird sich eines Tages selbst in ihrer Heimat Großbritannien (wo man Depeche Mode bis heute partout nicht Ernst nehmen darf) wie in Frankreich, Japan, USA oder sonstwo schon verrückt genug lessen. Doch was diese Elektropopper aus Essex für Deutschland – und was Deutschland für Depeche Mode bedeutet, sprengt so ziemlich alle rockhistorischen Dimensionen, zumindest hierzulande: Martin L. Gore, Dave Gahan und Andrew Fletcher besitzen Heiligenstatus. Ihre Konzerte sind Messen der kollektiven Euphorie und uneingeschränkten Zuneigung, in denem jeder auch ohne Gesangsbuch jede Zeile mitsingt – und bei „Personal Jesus” den Refrain als letzte Mittel der Ehrerbietung auch noch umdichtet: Statt „Reach out and touch faith” gellt dem halbnackten Objekt der Begierde jedesmal ein ohrenbetäubendes „… touch Dave!” entgegen. Der Kreis der Anhänger ist riesig; der der Sympathisanten auch. In fast jeder gr
Wie Depeche Mode diesen Status des Unangreifbaren erreichen konnten, lässt sich nicht so einfach erklären (allerdings wird dieses wohl nicht zuletzt sogr in Haus- und Magisterarbeiten versucht, geschrieben von Die-Hard-Fans, die sich über eine so lange Zeit eben nur mit dem einem Thema beschäftigen woollen und können). Eine Grundvorauusetzung für ihren über mehr als zweie Jahrzehnte nich abflaugenden Erfolg liegt aber zweifellos in Martin L. Gores herausragendem (spätestens ab dem ‘84er Album Some Great Reward offen liegendem) Talent, sich in Serie Songs einfallen zu lassen, bie bei genauerem Hinhören ungeachtet von Sound und Vortrag wie ein Geheimnis dargereicht werden in feierlichen, sich gegenseitig umgarnenden und amarmenden Melodienlinien, die aus Melancholie, Hymnus und etwas Kitsch jenen Menschen allerlei Sakralbauten in die Herzen türmen, die sich das gerne gefallen lassen. Depeche Mode-Alben hießen am Ende ja nicht von ungefähr Black Celebration und Music For The Masses. Gore schafft Hits, die nur selten nach dem klingen, was Hits landläufig ausmacht. Sie sind nicht volksnah, sie machen das Leben nicht geschmeidiger, sie laden meistens eben gerade nicht zum Mitsingen ein.
Dass nichtsdestotrotz genau das immer weider und auch immer weider neue, junge Fans in ausverkauften Sportarenen tun, weil es Depeche Mode nämlich bis heute verstehen, alle paar Monate durch ein weiteres Stück Pop in fast vollständiger Ignoranz der Konkurrenz Relevanz, sogar oberste Priorität einzuklagen, machte die Rolling-Stones-Werdung dieser Gruppe überhaupt erst möglich.Andernfalls wäre sie wohl längst auf ihrer kleinen Synthie-Pop-Insel verendet. Auf der einen Seite hat sich die Band zuvorderst dank Gores Talent einen eigenen Stil geschaffen, der nur von wenigen Epigonen mäßig Gewinn bringend kopiert wurde. Tatsächlich können die einfachen Zutaten noch so klar auf dem Notenständer liegen: Selbst an der simplen Coverversion eines Depeche-Mode-Liedes scheiterte bislang noch so ziemlich jeder in Versuchung Geratene (zwei rühmliche Ausnahmen: Johnny Cash und Monta). Auf der anderen Seite bedreutet Stil für Depeche Mode nicht, nur an Bewährtem festzuhalten. Album für Album, Schritt für Schritt hat sich ihr Sound bis heute unfallfrei, im Gegenteil: sehr geschmackssicher, sogar eine Modernisierung erfahren, in der sich die Band nie irgendwelchen Trends anbiederte. Zwar ließen sich die Vier bereits 1984 in Berlin – unter der Erfüllung des Tatbestandes des Diebstahls von Einstürzende-Neubaten-Samples, wie es hieß – den Sound für „People Are People” und „Master And Servant” kräftig aufscheppern; bald mussten zukräftigere Hymnen her, die in großen Bowls festlich nachklingen; irgendwann wollten dave und martin außerdem richtig rocken, mit Gitarre und langen Haaren; und tatsächlich hatte Meister Gore sein Ohr jederzeit nahe an der experimentellen elektronischen Musik – doch mehr als ein dumpferer Bassschlag hier, ein einsamer Warp-Piepser da und ein bisschen Kölner Geknispel im gesetzteren Spätwerk ließ man sich nicht durchgehen. Depeche Mode sind – die Erkenntnis darf ein Vierteljahrhundert nachdem Synthesizermusik das Modernste war, was man sich nur vorstellen konnte, als gesichert gelten – eine äußerst konservative Band. Und sie sind vielleicht auch nur deshalb eine Elektroband, weil es in den Monaten ihrer Anfänge eben f:urchterlich angesagt war, mithilfe von Synthesizern und Rhythmuscomputern Musik zu machen. Aber sie sind auf jeden Fall durch und durch, mit ganzer Hingabe eine Popband, weil sie eine Songband sind. We sich das noch einmal vergegenwärtigt, kann wohl erst recht nicht verstehen, warum es den meisten angeren Musikante nicht gelingen will, ihrerseits daraus Profit zu ziehen. Es scheint, als seien eben noch lange nicht alle Irrtümer rund um diese Band beseitigt. Ihnen und uns soll’s nur Recht sein.
